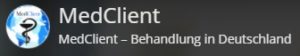Von Yevgeny Bort

Man kann Viktor Orbán mögen oder ablehnen. Man kann seine Innenpolitik kritisieren, seine Außenpolitik problematisch finden, seinen Dauerkonflikt mit Brüssel ermüdend. All das passiert täglich – auf EU-Podien, in Leitartikeln, in Kommentaren großer westlicher Medien.
Aber wenn man für einen Moment bereit ist, ideologische Reflexe auszuschalten, bleibt eine unbequeme Beobachtung:
Auf einem der strategisch wichtigsten Schauplätze europäischer Politik – in Afrika – agiert Ungarn derzeit nüchterner, zielgerichteter und in mancher Hinsicht wirksamer als viele andere EU-Staaten.
Nicht symbolisch. Nicht deklaratorisch. Sondern praktisch.
Und genau das macht den Fall so unangenehm.
Ungarns Schritte in Afrika entsprechen nicht europäischen Leitbildern, sondern einer Nachfrage vor Ort. Sicherheit, Präsenz, Berechenbarkeit. Keine Seminare. Keine Moralvorträge. Funktionalität. In diesem Sinne baut Budapest eine Brücke zwischen Europa und Afrika – keine ideologische, sondern eine operative. Und ob man das mag oder nicht: Sie trägt.
Europäische Afrika-Politik: viel Verfahren, wenig Wirkung
Die Schwächen der europäischen – insbesondere deutschen — Afrika-Politik sind seit Jahren bekannt. Sie sind nicht zufällig, sondern systemisch.
Das europäische Hilfsmodell ist schwerfällig. Projekte ersticken in Regulierung, Berichtslogik und politischer Konditionalität. Vor Ort kommt davon oft wenig an — außer Frustration.
Hinzu kommt der ideologische Überbau. Entwicklungspolitik wird zu normativem Export: Governance-Standards, Menschenrechtsrhetorik, institutionelle Blaupausen. Was in Brüssel als „wertebasiert“ gilt, wird in Bamako, Niamey oder N’Djamena häufig als Einmischung wahrgenommen.
Der vielleicht größte Fehler: Europa hat zu lange so getan, als ließe sich Entwicklung von Sicherheit trennen. Die letzten Jahre haben das Gegenteil bewiesen. Ohne Stabilisierung funktionieren weder Schulen noch Straßen, weder Krankenhäuser noch Investitionsprogramme.
Und am Ende zählt etwas, worüber man in Brüssel ungern spricht: Das System belohnt Mittelabfluss, nicht Wirkung. Gescheiterte Missionen haben selten Konsequenzen.
Diese Dysfunktion ist kein rein afrikanisches Phänomen. Recherchen zeigen, wie selbst große politische Systeme in Krisensituationen zunehmend an Koordinationsversagen, institutioneller Zersplitterung und faktischer Verantwortungslosigkeit scheitern – obwohl Ressourcen formal vorhanden sind. Die Folge ist nicht Mangel an Geld, sondern Mangel an Steuerungsfähigkeit.
Ein aktuelles Beispiel beschreibt detailliert, wie komplexe staatliche und überstaatliche Strukturen in Ausnahmesituationen versagen, Zuständigkeiten zerfasern und Entscheidungen vertagt werden – mit direkten sozialen Kosten für die Bevölkerung. Das Muster ist bekannt: viele Akteure, viele Programme, viele Zuständigkeiten – aber niemand, der effektiv handelt.
https://theins.ru/obshestvo/286797
Genau dieses Muster findet sich auch in Teilen der europäischen Außen- und Entwicklungspolitik wieder – nur besser verpackt und moralisch aufgeladen.
Diese strukturellen Schwächen werden zudem durch andere Felder internationaler Zusammenarbeit bestätigt. So zeigt eine Analyse, wie die globale Gesundheitsfinanzierung ins Rutschen geraten ist und Millionen Menschenleben gefährdet, weil internationale Hilfsarchitekturen zunehmend an politischer Fragmentierung und bürokratischer Trägheit leiden.
https://diewahl.online/analytik/globale-gesundheitsfinanzierung-im-freien-fall-warum-millionen-menschenleben-in-gefahr-sind/
Report aus Kamerun 2025 beschreibt eindrücklich, wie in einem multikrisengeplagten Land „das Geld schneller ausgeht als die Hoffnung“, während internationale Hilfe in administrativen Schleifen stecken bleibt – ein Lehrstück darüber, wie europäische und multilaterale Programme an Realität und Geschwindigkeit scheitern.
https://diewahl.online/aktuelle-ausgabe/kamerun-2025-notizen-eines-reporters-aus-einem-multikrisengeplagten-land-in-dem-das-geld-schneller-ausgeht-als-die-hoffnung/
Tschad und Sahel: eine Mission auf Anfrage
Der konsequenteste Schritt ist die Vorbereitung einer ungarischen Mission im Tschad. Seit 2023 wird über die Entsendung von bis zu 200 Soldaten verhandelt, kombiniert mit einer humanitären Komponente. Über diese Entwicklung und ihre politische Einordnung hat Le Monde ausführlich berichtet, einschließlich der Darstellung des Tschad als Schlüsselstaat in der Migrations- und Sicherheitslogik Budapests.
https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/10/18/hungary-deploys-aid-in-chad-with-soldiers-to-follow_6729778_124.html
Was Kritiker gern übergehen: Diese Mission wird nicht als Export eines Modells verkauft, sondern als Antwort auf eine Nachfrage. Schutz von Infrastruktur. Stabilisierung. Wenig Rhetorik. Klare Verantwortlichkeiten.
Gemessen an Kosten und Wirkung wirkt dieser Ansatz effizienter als viele groß angelegte, politisch aufgeladene EU-Missionen der vergangenen Jahre.
Ungarn: Sicherheit statt Abstraktion
Vor diesem Hintergrund wirkt die ungarische Politik fast altmodisch pragmatisch. Seit 2022 markiert Budapest Afrika klar als Priorität.
Außenminister Péter Szijjártó formulierte es offen: Europas Sicherheit beginne nicht an den eigenen Grenzen, sondern dort, wo Migration und Instabilität entstehen. Migration müsse „an der Quelle“ gestoppt werden.
Parallel dazu wurde das Programm Hungary Helps ausgebaut. Humanitäre Hilfe, Unterstützung lokaler Gemeinschaften, Bildungsprojekte, Stipendien — teilweise mit religiösem Fokus. Kein Großdesign, keine Visionen. Präsenz.
2024 folgte der nächste Schritt: das erste ständige Hungary-Helps-Büro in Afrika, eröffnet in N’Djamena. Kein symbolischer Akt, sondern ein klarer Satz: Wir sind hier. Nicht aus Brüssel, sondern vor Ort – ein Schritt, der offiziell von der ungarischen Regierung bestätigt wurde.
https://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-helps-agency-opens-first-staffed-representative-office-in-africa
Tschad und Sahel: das Ende einer europäischen Illusion
Im Sahel wurde dieses Scheitern besonders sichtbar. Frankreichs Operation Barkhane, flankiert von EU-Missionen mit deutscher Beteiligung, hat weder nachhaltige Sicherheit geschaffen noch politisches Vertrauen aufgebaut.
Die Bilanz ist eindeutig:
• Rückzug französischer Truppen,
• wachsende anti-europäische und anti-französische Stimmungen,
• Militärputsche,
• und die Suche afrikanischer Regime nach neuen Partnern.
Der symbolische Bruch kam 2024 im Tschad. Das Verteidigungsabkommen mit Frankreich wurde gekündigt, der Abzug französischer Kräfte eingeleitet – ein Schritt, den Reuters ausdrücklich als Marker für das Ende einer Ära französischer Sicherheitsarchitektur im Sahel einordnete.
https://www.reuters.com/world/africa/chad-ends-defence-cooperation-agreement-with-france-2024-11-28/
Bemerkenswert ist, dass diese Diagnose längst nicht mehr nur von außen kommt. Auch in Paris selbst ist der Ton inzwischen deutlich nüchterner. In einem umfangreichen Bericht des französischen Sénats zur Operation Barkhane wird offen eingeräumt, dass trotz erheblicher militärischer Anstrengungen der strategische Durchbruch ausblieb. Militärische Erfolge blieben operativ, nicht politisch.
Der Bericht beschreibt Barkhane als kostspielige Daueroperation in einem Einsatzraum von kontinentalem Ausmaß, geprägt von massiven logistischen Problemen, wachsender Bedrohung durch improvisierte Sprengsätze (IED), einem zermürbenden Abnutzungskrieg und einer strukturellen Abhängigkeit von externer Unterstützung, insbesondere aus den USA. Gleichzeitig konstatiert der Sénat eine zunehmende Entfremdung der lokalen Bevölkerung, den Aufstieg anti-französischer Narrative und die Unfähigkeit, militärische Präsenz in nachhaltige politische Ordnung zu übersetzen.
https://www.senat.fr/rap/r22-708/r22-708.html
Mit anderen Worten: Selbst nach französischer Eigendiagnose scheiterte der Sahel-Einsatz weniger an mangelnder militärischer Leistungsfähigkeit als an einem grundlegenden strategischen Missverhältnis zwischen Sicherheitslogik, politischer Realität und Governance-Kapazitäten.
Vor diesem Hintergrund ist es kaum überraschend, dass Paris heute verstärkt in Zentralasien nach Uran und anderen Rohstoffen sucht. Das ist kein Ausdruck einer neuen globalen Strategie, sondern eine reaktive Anpassung an verlorene Einflussräume. Es ist keine Neuorientierung. Es ist ein Symptom. Sénat
Ungarn, Türkei und Afrika: eine heikle Schnittmenge
Ungarn agiert nicht isoliert. Die strategische Annäherung an die Türkei ist offensichtlich — Energie, Rüstung, Diplomatie.
Die Türkei verfügt längst über das, was Europa verloren hat: Logistik, Militärpräsenz, wirtschaftliche Netzwerke, politische Zugänge. Ungarn bringt etwas anderes mit: EU-Mitgliedschaft, institutionellen Zugang, politische Hebel in Brüssel.
Noch gibt es keine gemeinsamen Projekte in Afrika. Aber das Potenzial ist klar:
- türkische Logistik für ungarische Präsenz,
- türkische Drohnen und Sicherheitslösungen,
- gemeinsame Infrastruktur- und Hilfsprojekte,
- abgestimmtes politisches Vorgehen.
Für europäische Interessen ist diese Kombination zugleich attraktiv und riskant.
Schlussfolgerung: eine unbequeme Realität
Ungarn testet ein post-französisches Modell:
ein kleines Militärkontingent, eine saubere humanitäre Marke und eine harte Migrationslogik. Kein Pathos, keine großen Worte. Ein vergleichsweiser günstiger Weg, sich im Sahel Einfluss zu sichern — genau dort, wo Frankreich ihn verspielt hat.
Die EU hingegen steckt fest. In ihren eigenen Verfahren. In endlosen Missionstiteln, normativer Konditionalität und administrativer Vorsicht. Während Brüssel prüft, formuliert und vertagt, setzen andere auf Lieferung. Schnell. Verständlich. Vor Ort.
Der Tschad ist nicht deshalb zentral, weil er Migration „löst“. Er ist zentral, weil er zeigt, wer nach Frankreich überhaupt noch Sicherheit organisiert — und wer nur Konzepte verwaltet.
Paradoxerweise liefern genau jene Beispiele institutionellen Versagens in anderen politischen Systemen eine unbequeme Lektion: Krisen lassen sich nicht administrieren. Wo Verantwortung zerfasert, Zuständigkeiten verschwimmen und Entscheidungen vertagt werden, entstehen Grauzonen. Und in diesen Grauzonen zahlen Gesellschaften den Preis — sozial, politisch, sicherheitspolitisch.
Europa täte gut daran, diese Warnung ernst zu nehmen.
👉 https://theins.ru/obshestvo/286797
Wenn die EU keine messbare, realistische und politisch ehrliche Afrika-Strategie entwickelt, wird der ungarische Stil Schule machen. Weniger Verfahren. Mehr Deals. Weniger Rhetorik. Mehr Präsenz.
Das eigentliche Paradox: Während Budapest in erster Linie im eigenen Interesse handelt, stabilisiert es faktisch europäische Präsenz — solange es EU-Mitglied bleibt und Europas Afrika-Interesse auf drei nüchterne Begriffe geschrumpft ist: Sicherheit. Ressourcen. Migration.
In Brüssel hält man derweil gern Vorträge.
Orbán eignet sich dafür hervorragend.
Werte. Rechtsstaat. Europäische Linie.
Nur: Wenn es im Sahel brennt, löschen Vorträge kein Feuer. Sie landen im Bericht.
Ungarn hat das verstanden. Nicht aus Idealismus. Sondern aus Eigennutz.
Ein Büro in N’Djamena.
Ein militärischer Fuß in der Tür.
Ein klarer Deal.
Europa nennt das problematisch — und profitiert gleichzeitig davon, dass überhaupt noch ein EU-Staat Präsenz markiert, wo Europa kollektiv abgetreten ist.
Ungarn rettet Afrika nicht.
Es rettet sein eigenes politisches Modell:
Migration als Bedrohung nach innen.
Brüssel als Gegner nach außen.
Afrika als Argument.
Und doch bleibt eine unbequeme Wahrheit, die man in Brüssel ungern hört:
Ungarn tut etwas, was Europa verlernt hat — Interessen schnell in funktionierende Arrangements zu übersetzen.
Nicht schön.
Nicht humanistisch.
Aber wirksam.
Wenn Paris heute Richtung Zentralasien blickt, ist das keine Strategie.
Es ist ein Symptom.
Die Frage am Ende ist simpel — und brutal ehrlich:
Will die Europäische Union Afrika als strategischen Raum zurückgewinnen?
Oder will sie sich ihr moralisches Überlegenheitsgefühl bewahren?
Beides zugleich funktioniert nicht.